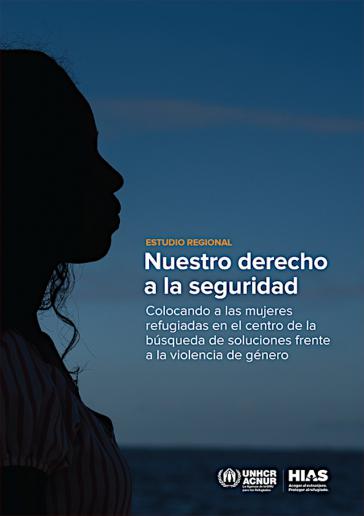Panama-Stadt. Eine neue Studie des Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) und der humanitären Organisation Hias (Hebrew Immigrant Aid Society) belegt, dass gewaltsam vertriebene Frauen und Mädchen in Lateinamerika und der Karibik einem hohen Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind. Indigene Frauen sind besonders betroffen.
Die Frauen berichten, sowohl im Heimatland als auch während der Flucht und im Zielland Gewalt zu erfahren; drei von fünf sprechen zudem davon, dass sich das Risiko durch die Covid-19 Pandemie noch erhöht hat.
Laut José Samaniego, UNHCR-Regionaldirektor für Nord- und Südamerika, ist die Region "mit einer noch nie dagewesenen Situation der Vertreibung konfrontiert, von der Millionen von Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung sind, unverhältnismäßig stark betroffen sind." Es sei von entscheidender Bedeutung, alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhindern und zu beseitigen, indem die institutionellen Maßnahmen gestärkt und die Gemeinschaften gestärkt würden.
Lateinamerika weist eine hohe Zahl Geflüchteter auf, eine von fünf vertriebenen Personen weltweit befindet sich dort. Während der Flucht erleiden 36 Prozent der Befragten sexualisierte Gewalt, 31 Prozent psychische und 13 Prozent physische Gewalt. Im Zielland wird am häufigsten von psychischer Gewalt (34) und sozioökonomischer Gewalt (18 Prozent) berichtet.
Die drei Hauptfaktoren für das erhöhte Risiko im Zielland sind laut der Studie die Xenophobie, das Fehlen ökonomischer Möglichkeiten sowie fehlende Information. Über die Hälfte der von geschlechtsspezifischer Gewalt Betroffenen kennt die eigenen Rechte und mögliche Anlaufstellen nicht. Viele Fälle werden nicht angezeigt.
Die Hias-Regionaldirektorin für Lateinamerika und die Karibik, Cristina Garcia, sagt dazu: "Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere die am stärksten gefährdeten Gruppen wie indigene Frauen, sind mit einem gravierenden Mangel an Hilfsangeboten konfrontiert ‒ darunter sichere Räume für Frauen und Mädchen, sichere Unterkünfte und medizinische Versorgung ‒ sowie mit Hindernissen beim Zugang zu Justiz und Schutz".
Um die Situation zu verbessern, bräuchten die Befragten nach eigenen Angaben Unterstützung zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit (63 Prozent), Informationen über die eigenen Rechte und mögliche Anlaufstellen (50 Prozent), sowie Asyl und Wege zur geregelten Einwanderung (50 Prozent).
In Lateinamerika ist geschlechtsspezifische Gewalt allgemein ein großes Problem. Laut Cepal (Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik) werden pro Tag in der Region zwölf Feminizide registriert. Zwischen 63 und 76 Prozent der Befragten in verfügbaren nationalen Erhebungen haben im Laufe ihres Lebens diese Form der Gewalt erlebt.
Da Regierungen zum Thema oftmals schweigen, sind es in vielen Ländern feministische Organisationen und Aktivist:innen, die die Wege zur Datenerhebung und für die Sichtbarkeit des Problems ebnen.
Die "Vereinigung der indigenen Frauen Paraguays" erklärte jüngst, dass es im Land ein institutionelles Versagen bei der Gewährleistung der Sicherheit von Mädchen gebe. Besonders indigene Mädchen seien davon betroffen. Nach dem Mord an einer 13-Jährigen beklagte Tina Alvarenga, eine Sprecherin der Organisation: "Die Unsichtbarkeit der Fälle, das Schweigen und die komplizenhafte Straflosigkeit seitens der Behörden bestehen weiter fort."